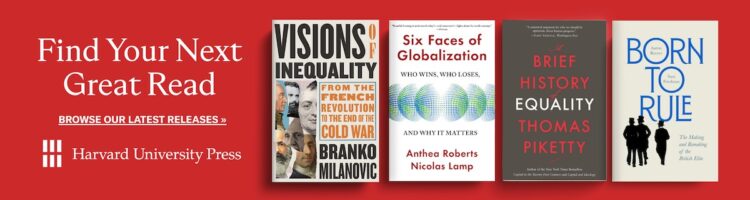Vor wenigen Wochen haben Uğur Şahin und Özlem Türeci das Bundesverdienstkreuz für ihre patentgeschützte Entwicklung des weltweit ersten Covid-19-Impfstoffs erhalten. Die beiden stehen sinnbildlich für den unverzichtbaren Beitrag, den Migration inzwischen zur Innovationskraft Deutschlands leistet und den wir in einer aktuellen Analyse quantifiziert haben.
Grundlage dieser Analyse ist die Gesamtheit aller Patente, die im Zeitraum von 1994 bis 2018 hierzulande Schutzwirkung angestrebt haben (zB über eine Anmeldung beim Deutschen Patent- und Markenamt, Europäischen Patentamt oder der Weltorganisation für geistiges Eigentum) und an denen mindestens ein Erfindender mit Wohnsitz in Deutschland beteiligt war.

Die Auswertung erfolgt mittels eines eigens entwickelten Vornamensmoduls, welches die rund 38.000 verschiedenen Vornamen aller in Deutschland wohnhaften Erfindenden beinhaltet, die seit dem Jahr 1994 an einer Patentanmeldung mit angestrebter Schutzwirkung für Deutschland beteiligt waren. In der Folge wurden diese Vornamen einem oder mehreren von insgesamt 24 Sprachräumen zugeordnet, um jene Region der Welt zu bestimmen, in der mit hoher Wahrscheinlichkeit die Wurzeln der betreffenden Person liegen. Rund 92 Prozent dieser Vornamen sind spezifisch für einen bestimmten Sprachraum—Uğur und Özlem z.B. für den türkischen, Heinz und Hildegard zB für den deutschen.
Insgesamt 11,2 Prozent aller in Deutschland entwickelten Patente gehen inzwischen vollumfänglich auf Erfindende mit ausländischen Wurzeln zurück. Im Jahr 1994 lag der dieser Wert erst bei 3,8 Prozent und ist seither kontinuierlich gestiegen. Anders formuliert zeichneten Erfindende mit ausländischen Wurzeln kurz nach der Wiedervereinigung erst für knapp jedes 25. in Deutschland entwickelte Patent verantwortlich, inzwischen jedoch bereits für jedes neunte.
Natürlich leisten auch im Ausland wohnhafte Erfindende einen Beitrag zum Innovationsgeschehen in Deutschland. Da in dieser Studie jedoch der explizite Beitrag von Migration nach Deutschland gemessen wird, wurden Anteile von Erfindenden mit Wohnsitz im Ausland von der Analyse ausgenommen. Eine unvermeidbare Untererfassung von Migration entsteht sogar noch dadurch, dass Vornamen aus dem spezifisch deutschen Sprachraum unter anderem in Österreich sowie in Teilen der Schweiz und Norditaliens Verwendung finden.
Unter dem Strich ist die kumulierte Anzahl der in Deutschland entwickelten Patentanmeldungen insgesamt zwischen 2008 und 2018 um 2,9 Prozent gestiegen, jene von Erfindenden aus dem deutschen Sprachraum jedoch um 1,8 Prozent gesunken, während jene von Erfindenden aus nichtdeutschen Sprachräumen um 84 Prozent gestiegen ist, darunter jene von Erfindenden aus dem indischen bzw. chinesischen Sprachraum gar um 303 bzw. 139 Prozent.
In anderen Worten: Der in den letzten zehn Jahren ohnehin nur moderate Aufwuchs bei den in Deutschland entwickelten Patentanmeldungen ist ausschließlich Erfindenden mit ausländischen Wurzeln zu verdanken. Ohne sie wäre die gesamtwirtschaftliche Patentaktivität Deutschlands gesunken.
Zwar ist die kumulierte Patentleistung von Erfindenden aus dem deutschen Sprachraum zwischen den Jahren 1994 und 2000 noch kontinuierlich gestiegen, seither stagniert sie jedoch und ist in den letzten zehn Jahren sogar gesunken. Die Ursachen hierfür liegen in der demografischen Entwicklung und verschärfend in den Arbeitsmarktengpässen technisch-naturwissenschaftlicher Qualifikationen und Berufe begründet, die ihrerseits maßgeblich für Forschung, Entwicklung und in der Folge auch Patentanmeldungen verantwortlich zeichnen.
Das demografische Problem lässt sich am einfachsten dadurch beziffern, dass in Deutschland auf 13,5 Millionen Menschen aus der 10-Jahrskohorte der Babyboomer nur noch 7,9 Millionen Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 5 und 14 Jahren kommen. Die Konsequenzen dieser Entwicklung haben längst die Hochschulen erreicht. Und da es in diesem Jahrtausend hierzulande nicht gelungen ist, pro Jahrgang mehr Studienberechtigte für ein technisch-naturwissenschaftliches Studium zu motivieren, sinkt das quantitative Potenzial der deutschen Erfindenden und folglich auch ihre aggregierte Patentleistung seit Jahren.
Eine wenig zielführende Sichtweise besteht darin, die Hochschulkapazitäten zu reduzieren, was zynisch als Abschöpfen der demografischen „Rendite“ bezeichnet wird. Die notwendige und einzig sinnvolle Lösung besteht vielmehr darin, die Hochschulkapazitäten zumindest beizubehalten und Studierende aus dem Ausland für ein Studium in Deutschland zu begeistern.
Ein genauerer Blick auf die Zuwanderungsströme technisch-naturwissenschaftlicher Fachkräfte zeigt, dass diese zwar oft als fertig ausgebildete Akademiker aus dem Ausland nach Deutschland zugewandert sind. Doch neben der klassischen Zuwanderung über den Arbeitsmarkt verfolgt Deutschland seit Jahren noch einen weiteren sehr erfolgreichen Weg: die Zuwanderung über die Hochschulen. Insbesondere die deutsche Ingenieur- und Informatikerausbildung genießt international einen sehr guten Ruf und auch die Tatsache, dass das Hochschulstudium in Deutschland auf Studiengebühren verzichtet, macht es sehr attraktiv für Studierende aus dem Ausland.
Ever since the UK announced the BREXIT (and dropped out of Erasmus) and the Trump-US chose to deter high-skilled students from abroad, Germany has noted an increasing number of students particularly from India, China and Spanish-speaking home countries, many of them STEM-students. In technisch-naturwissenschaftlichen Studiengängen waren zuletzt zu rund einem Viertel Bildungsausländer eingeschrieben, Personen also, die ihre Hochschulzugangsberechtigung im Ausland erworben haben und zum Studium nach Deutschland gekommen sind. Immerhin die Hälfte der Absolventen aus diesem Personenkreis verbleibt nach dem Examen in Deutschland und trägt dauerhaft zur Wertschöpfung hierzulande bei.
Kritiker der kostenfreien Hochschulbildung monieren, dass die andere Hälfte Deutschland wieder verlässt und dadurch ein Braindrain entsteht, in dessen Konsequenz Deutschland die Ausbildungskosten trägt, andere Länder jedoch die zugehörigen Erträge abschöpfen. Erfreulicherweise erachtet die politische und gesellschaftliche Mehrheitsmeinung das Glas als halbvoll und eine nüchterne fiskalische Betrachtung gibt dieser Sichtweise recht.
Die in Deutschland verbleibenden Absolventen überkompensieren durch ihre Steuern und Sozialabgaben nicht nur ihre eigenen Ausbildungskosten, sondern auch jene der abwandernden Hälfte. Darüber hinaus dürfte ein nicht zu unterschätzender Anteil der „abwandernden“ Hälfte in ausländischen Dependancen deutscher Industrieunternehmen tätig sein und ihre Arbeit somit einer Gesamtbetrachtung sehr wohl auch Deutschland zugutekommen. Ebenfalls nicht zu unterschätzen ist das (hoffentlich positive) Bild Deutschlands, das ausländische Studierende, die hierzulande ihre Ausbildung genossen haben, in ihre Heimatländer oder den Rest der Welt transportieren.
Als erfreulich erfolgreiche Maßnahme zur Stärkung einer Willkommenskultur hat sich das Portal „Make it in Germany“ etabliert. Es wurde hier im German Economic Institute entwickelt, im Jahr 2012 ins Leben gerufen und ist inzwischen das zentrale Informationsportal der Bundesregierung für alle Fragen rund um das Thema Einwanderung nach Deutschland. Ziel des Portals ist es, weltweit Fachkräfte dafür zu begeistern, in Deutschland zu arbeiten. Grundlage dafür ist eine Kultur in Politik, Gesellschaft, Verwaltung und Unternehmen, die zum Bleiben in Deutschland einlädt.
„Make it in Germany” zeigt ein modernes und vielfältiges Bild von Deutschland und trägt dazu bei, die Bundesrepublik als sympathisches und weltoffenes und damit für qualifizierte Fachkräfte attraktives Land zu präsentieren. Das Portal stellt umfangreiche Informationen zu Einreise- und Visumsverfahren, Familiennachzug, Jobsuche und Alltag in Deutschland zur Verfügung. Zudem werden die Möglichkeiten einer Ausbildung oder eines Studiums in Deutschland aufgezeigt.
Im Innovationsbereich steht Deutschland vor gewaltigen Herausforderungen – von Dekarbonisierung, Gesundheitsschutz und Digitalisierung bis zum technologischen Konkurrenzkampf mit China. Nur durch mehr Innovationen und damit Weltoffenheit und Zuwanderung können diese Herausforderungen gemeistert und gleichzeitig der Wohlstand gesichert werden.
Ein Problem dabei ist, dass in der momentanen Corona-Pandemie kaum noch ausländische Studierende und Fachkräfte nach Deutschland kommen (können) und sich dies bald negativ auf die Innovationsleistung auswirken dürfte. Und hier schließt sich der Kreis, haben doch mit Uğur Şahin und Özlem Türeci zwei Erfinder mit ausländischen Wurzeln eine wirksame Lösung für die Ursache dieses Problem entwickelt.